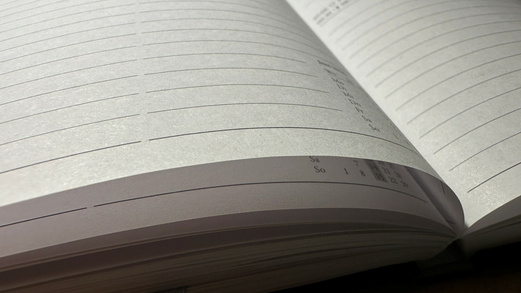Der Prozess „GlaubensRäume gestalten“
Kirchen sind bedeutsame Räume: mit eigener Ausstrahlung und Anziehung. Sie werden gesucht und besucht, im Alltag und im Urlaub. Sie bieten Raum für Gott, für Menschen, für Kunst, für Stille, Gespräch und Musik.
Damit dies so bleibt, muss Kirche leben. Sonst werden unsere Räume stumm und traurig. Was wir nicht wollen, sind Gotteshäuser, in denen sich nur wenige zum Gottesdienst versammeln, oder Gemeindehäuser, die viel Energie verbrauchen und nur selten genutzt werden. Auch Pfarrhäuser, die leer stehen, sind keine Lösung.
Manche Gebäude können wir uns deshalb nicht mehr leisten.
Finanziell. Aus Klimaschutzgründen. Oder weil sie für die künftige Gemeindearbeit nicht mehr benötigt werden. Deshalb müssen wir überlegen, wie wir mit unseren vielen Bauwerken umgehen, wie wir sie mit neuem Leben füllen. Es geht um Fragestellungen wie: Können wir unsere Gebäude klimafreundlich sanieren oder müssen wir uns vielleicht auch von einigen lieb gewonnen Gebäuden trennen, damit andere wiederbelebt werden.
Daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten.
Menschen aus den Kirchengemeinden sind in dieser Prozessen genauso gefragt wie Menschen mit Kompetenz in Gebäude- und Klimaschutzfragen. Und wir holen uns Interessierte aus der Region dazu, damit auch sie ihre Ideen einbringen. Diejenigen, die räumlich am nächsten dran sind, wissen am besten, wofür ein Gebäude steht. Und wie es um ein Gebäude steht.
Ablauf und Zeitrahmen
Der Prozess „GlaubensRäume gestalten“ wurde im März 2025 per Gesetz von der Synode der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg beschlossen: Bis 2030 sollen 30 Prozent der Gebäudekosten und bis 2035 sollen 90 Prozent des CO2-Ausstoßes reduziert werden.
Die Fakten
Die Zahl der Gemeindeglieder sinkt.
Sie ist in den vergangenen 20 Jahren bereits um etwa 25 Prozent gesunken. Ausgehend von ca. 330.000 Mitgliedern Ende 2026 erwarten wir bis 2035 einen Rückgang um ca. 40 Prozent. Das wären dann nur noch rund 200.000 Gemeindeglieder in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg.
Die Zahl der Gebäude sinkt ebenfalls – aber weniger stark.
Der Gebäudebestand, der für die kirchengemeindliche Arbeit zur Verfügung steht, ist in den letzten 20 Jahren um ca. zehn Prozent geschrumpft. In erster Linie wurden Pfarrhäuser und Gemeindehäuser aufgegeben.
Wir werden weniger Geld haben.
Aufgrund der Prognosen zur Kirchensteuerentwicklung müssen wir von deutlich sinkenden Einnahmen ausgehen. Und angesichts der weltweiten Krisen müssen wir zudem mit Preissteigerungen und instabilen Preisentwicklungen rechnen.
Wir müssen sparen.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 ihre Ausgaben um 30 Prozent zu reduzieren. Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg steht also nicht alleine vor der Aufgabe, die Ausgaben zu senken.
Wir brauchen Geld.
Wir benötigen weiterhin erhebliche finanzielle Ressourcen für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für Bildung und vielfältige diakonische Aufgaben, für Kirchenmusik und Gemeindeleben. Dies bedeutet dann aber auch, dass wir nicht gleichzeitig beträchtliche Summen in die Sanierung von Gebäuden ohne Zukunftsperspektive investieren können.
Wir wollen uns für den Klimaschutz engagieren.
Die Synode der oldenburgischen Kirche hat sich 2023 mit dem „Kirchengesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg“ verpflichtet, Treibhausgasneutralität zu erreichen – mit besonderem Fokus auf den Gebäuden. Das „Kirchengesetz zur Erstellung von Gebäudeeffizienzplänen“ der Synode vom März 2025 bezieht zusätzlich die finanziellen Herausforderungen mit ein.
Klimaschutz kostet Geld – und spart auf lange Sicht.
Die energetische Sanierung von Gebäuden erfordert erhebliche Investitionen, zahlt sich aber auf Dauer durch niedrigere Betriebskosten aus.
Es gibt also gute Gründe für einen am tatsächlichen Bedarf orientierten, klimaverträglichen und finanzierbaren Gebäudebestand.
Um das zu erreichen, haben wir uns entsprechende Ziele gesetzt.
Die Ziele
Der Prozess hat zwei Ziele, die eng miteinander verknüpft sind:
- 30 Prozent weniger Gebäudekosten für die Kirchengemeinden
- 90 Prozent weniger CO2-Ausstoß
Eine sinnvolle energetische Sanierung von Gebäuden bedeutet auf lange Sicht und in aller Regel eine Kostenersparnis. Sie ist also unverzichtbarer Teil der Lösung. Deshalb liegt es auf der Hand, beide Aufgaben gemeinsam anzugehen – zumal auch staatliche Vorgaben umzusetzen sind.
Kostenersparnis durch energetische Sanierung und effektive Nutzung sind also der beste Weg, um kirchliche Räume zu erhalten.
90 Prozent weniger CO2-Ausstoß ist machbar!
Das Rechenbeispiel zeigt:
- Ein treibhausgas-neutraler Gebäudebestand ist möglich.
- Eine Kombination aus mehreren Maßnahmen ist notwendig.
- Es ist zwingend erforderlich, den Energieverbrauch zu senken.
Arbeitsmittel
Für die Arbeit in Kirchengemeinden, Arbeitsgruppen und Gebäudeplanungsteams (GPTs) stehen auf dieser Seite verschiedene Arbeitsmittel zur Verfügung.
Um die Öffentlichkeit umfassend über den Prozess und alles, was damit zusammenhängt, zu informieren, stellen wir auch verschiedene Texte und Textbausteine unserer Autorin Daniela Conrady für die Kommunikation bereit. Diese können für Gemeindebriefe, Webseiten oder weitere Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.
Arbeitsmittel für Kirchengemeinden, Arbeitsgruppen und Gebäudeplanungsteams (GPTs)
Textbausteine für Gemeindebriefe, Webseiten und weitere Öffentlichkeitsarbeit
- Kirche muss sich neu definierenEv.-Luth. Kirche in Oldenburg überdenkt mit dem Gebäudeeffizienzplangesetz nicht
nur den Erhalt von Gebäuden - Das GebäudeeffizienzplangesetzOldenburgische Kirche erlässt Gebäudeeffizienzplangesetz
- GebäudeeffizienzpläneOldenburgische Kirche nimmt Gebäudebestand unter die Lupe
- Vergleichsjahr 2018 – Gebäude der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg auf dem Prüfstand
- GebäudeentwicklungsräumeEv.-Luth. Kirche in Oldenburg will neue Glaubensräume schaffen
- GebäudenutzungOldenburgische Kirche überdenkt Gebäudenutzung
- Neu-Definition KircheEv.-Luth. Kirche in Oldenburg startet innovativ in die Zukunft
Fördermittel für die Beratung und Unterstützung zur Erstellung von Gebäudeeffizienzplänen
Rechtliche Grundlagen
- 6.300 Kirchengesetz zur Erstellung von Gebäudeeffizienzplänen (Gebäudeeffizienzplangesetz – GePG) – Kirchenrecht Online-Nachschlagewerk
- 6.310 Rechtsverordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Erstellung von Gebäudeeffizienzplänen (RV-GePG) – Kirchenrecht Online-Nachschlagewerk
- 6.222 Kirchengesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg (Klimaschutzgesetz) – Kirchenrecht Online-Nachschlagewerk
- 6.223 Klimaschutzverordnung der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg (Klimaschutz-VO) – Kirchenrecht Online-Nachschlagewerk
Senden Sie uns Ihre Fragen, Anregungen, Veranstaltungsvorschläge und andere Dinge rund um den Prozess “GlaubensRäume gestalten” gerne per E-Mail an umwelt@kirche-oldenburg.de.
Allgemeine Fragen
Ziel ist nicht primär, die Zahl der Gebäude zu reduzieren, sondern die Kosten für die Gebäude, also die Gebäudelast.
Zurückgehende Mitgliedszahlen und damit auch zurückgehende Finanzmittel auf der einen Seite und steigende Betriebs- und Unterhaltungskosten auf der anderen Seite stellen immer mehr Kirchengemeinden vor große finanzielle Probleme. Mancherorts reichen die Schlüsselzuweisungen der oldenburgischen Kirche schon nicht mehr aus, die Gebäudekosten zu bestreiten. Andere Arbeitsfelder können dann zwangsläufig nur über Spenden finanziert werden.
Diese Situation zwingt dazu, zu überprüfen, welche Gebäude für die kirchliche Arbeit benötigt werden und wie diese effizient genutzt werden können.
Der Prozess „GlaubenRäume gestalten“ zielt in erster Linie auf die Reduzierung der Kosten und der CO2-Emissionen. Gelingt es, die Relation von Einnahmen und Kosten zu verbessern und durch entsprechende Maßnahmen den CO2-Ausstoß um die geforderten 90 Prozent zu verringern, dann muss es in dem Fall keine Reduktion der Gebäude geben, da damit schon die Kosten refinanziert sind und CO2 eingespart ist.
Wie Gebäude beheizt und mit Energie versorgt werden, kann nicht von der Frage getrennt werden, wie sie in Zukunft unterhalten werden und welche Investitionen in die Instandhaltung nötig sind. Bei jeder Betrachtung des Investitions- und Betriebsbedarfs spielen die Beheizung, die Beleuchtung und der Zustand der Gebäudehülle eine zentrale Rolle. Die zusätzlichen Investitionen in den Klimaschutz sind dabei viel geringer (10 – 20 Prozent Mehrbedarf für einen hohen energetischen Standard) als die Kosten für die Sowieso-Instandhaltung.
Es ist eine Vereinfachung, wenn die Energiefragen direkt mit den Gebäudefragen gekoppelt werden, denn:
Die Gremien müssen sich in nur einem Prozess mit diesen Fragen auseinandersetzen.
- Die Betriebskosten können durch Klimaschutzmaßnahmen gesenkt werden. Mit Investitionen in die CO2-Reduzierung ist die Senkung von Betriebskosten verbunden.
- Fehlinvestitionen werden vermieden.
- Staatliche Fördermittel können besser einbezogen werden.
- Staatliche Vorgaben für Klimaschutz bleiben im Blick.
- Die Abgabe eines Gebäudes aus der kirchlichen Nutzung stellt eine Treibhausgas-Reduktion für das kirchliche CO2-Konto dar. Man kann zwar einwenden, dass das nur eine Verschiebung des Problems sei. Dem ist zu entgegnen, dass andere Eigentümer*innen über andere Finanzmittel verfügen und höhere Investitionen im energetischen Bereich leichter stemmen können als eine Kirchengemeinde. Auch kann dadurch, dass Immobilien von neuen Eigentümer*innen weiter genutzt werden, ein Neubau vermieden werden, was eine große Einsparung von sog. „grauer Energie“ darstellt.
- Die Einnahmen aus der Verwertung von Grundstücken können bei der Planung eines zukunftsfähigen, treibhausgasneutralen Gebäudebestandes verwendet werden.
- Hinzukommt, dass ist es für den Klimaschutz ein großer Vorteil ist, wenn er nicht als Extra-Prozess umgesetzt werden muss, sondern direkt in den bestehenden Strukturen Berücksichtigung findet.
Das 30-Prozent-Ziel ist im Hinblick auf die jeweiligen Kirchenkreise zu erreichen. Das bedeutet, dass der Kirchenkreis der Bilanzraum ist.
Im Prozessablauf ist vorgesehen, dass die Kirchengemeinden in Arbeitsgruppen entsprechend ihrer Gebäudeentwicklungsräume eingeteilt werden. In diesen Arbeitsgruppen ist zu erarbeiten, wie eine Reduktion um 30 Prozent der im Gebäudeentwicklungsraum bestehenden Gebäudelast zu erreichen ist. Deshalb ist die Zusammenarbeit wichtig. Denn nur im gemeinschaftlichen Zusammenwirken lässt sich das Ziel erreichen.
Grundsätzlich kann es jedoch auch Abweichungen davon geben, sofern trotz gemeinschaftlicher Anstrengung der Gebäudeentwicklungsraum die 30 Prozent nicht schafft. Ein Weniger an der einen Stelle erfordert aber ein Mehr an anderer Stelle. Dies erfordert dann eine Verständigung über den eigenen Gebäudeentwicklungsraum hinaus.
Am Ende müssen aber die 30 Prozent in jedem Kirchenkreis eingespart werden.
Auf der Website www.glaubensraeume-gestalten.de finden Sie Informationen und Materialien zum Gebäudeprozess. Darüber hinaus können Sie gerne den Newsletter „GlaubensRäume gestalten” abonnieren.
Dieser informiert in unregelmäßigen Abständen alle Interessierten über die neuesten Entwicklungen.
Die Kosten für die fachliche Expertise Dritter können nur dann gefördert werden, wenn eine Unterstützung durch den Fachbereich Bau der Evangelisch-Lutherischen Kirche Oldenburg aus dessen Perspektive nicht möglich ist. Damit soll erreicht werden, dass zunächst das vorhandene Know-how innerhalb unserer Kirche genutzt wird.
Die 9. Tagung der 49. Synode im Mai 2024 hat für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 Finanzmittel in Höhe von jeweils 400.000 € beschlossen. Die Mittel sind zweckgebunden für Beratung und Unterstützung zur Erstellung von Gebäudeeffizienzplänen (GeP) gemäß Gebäudeeffizienzplangesetz (GePG). Nicht ausgegebene Mittel werden ins Folgejahr übertragen.
Die Beantragung der Mittel erfolgt grundsätzlich über die Kreiskirchenräte. Auf der Website finden ist die Richtlinie für die Vergabe der Mittel veröffentlicht.
Gebäudelisten
Bitte sprechen Sie zunächst mit Ihrem Gebäudeplanungsteam. Sollte dort keine Lösung gefunden werden, wenden Sie sich bitte an die Arbeitsstelle für Umweltfragen und Klimaschutz. Diese übernimmt dann die weitere Koordinierung. Das persönliche Gespräch und der Austausch sind uns wichtig. Aus organisatorischen Gründen ist es jedoch einfacher, wenn Anfragen per E-Mail an umwelt@kirche-oldenburg.de geschickt werden, da für die Beantwortung der Fragen in der Regel unterschiedliche Bereiche und Fachleute einbezogen werden müssen.
Die Gebäudelisten dienen im Gebäudeprozess als unterstützendes Arbeitsmaterial. In Rücksprache mit den Arbeitsgruppen dürfen selbstverständlich sowohl inhaltliche als auch strukturelle Änderungen vorgenommen werden. Wir empfehlen strukturelle Änderungen (z.B. neue Spalten oder Spalten löschen) immer in Absprache mit dem Gebäudeplanungsteam vorzunehmen, damit die Listen innerhalb von Kirchenkreisen vergleichbar bleiben.
Bei Änderungen (z.B. Baujahr) in den Bereichen "Gebäude" und "Allgemeine Kennzahlen" hingegen bitten wir darum keine eigenständigen Änderungen vorzunehmen und im Vorfeld eine Mail an umwelt@kirche-oldenburg.de zu senden. Diese Daten müssen unter Umständen auch an anderen Stellen angepasst werden und so können wir Synergien nutzen.
Für die Planung zur Umsetzung der Reduktionen gemäß § 1 Absatz 2 GePG (Gebäudeeffizienzplangesetz) sind die Zahlen des Jahres 2018 ausschlaggebend. Damit sind Verkäufe und Maßnahmen, die vor 2018 getätigt wurden grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
Wenn bei der Erstellung des Gebäudeeffizienzplans für den Kirchenkreis die Einsparungsziele trotz ambitionierter Planungen nicht erreicht werden können, kann für diese Gebäude eine Ausnahme gemäß § 11 GePG beantragt werden.
Die Arbeitsstelle für Umweltfragen und Klimaschutz arbeitet mit den Kolleg*innen aus dem Fachbereich Bau und Liegenschaften derzeit mit Hochdruck daran, den Kirchengemeinden voraussichtlich bis Sommer 2026 Energiekurzberichte zukommen zu lassen, aus denen die aktuellen Verbräuche hervorgehen.
Kirchlich genutzte Gebäude, die den Kirchengemeinden gehören, aber dem Pfarrvermögen zugeordnet sind sind ebenfalls im Gebäudeeffizienzplan zu berücksichtigen.
Da eine Belegung im Jahr 2018 kaum nachvollziehbar sein dürfte, sind die aktuellen Zahlen im Belegungsplan zu berücksichtigen.
Der Belegungsplan ist als Hilfsmittel im Prozess zu verstehen. Für kein Gebäude besteht eine Ausfüllpflicht. Nutzen Sie den Plan dort, wo er sinnvoll ist und Ihre Arbeit unterstützt.
Für ihre Arbeit sind Kirchengemeinden darauf angewiesen, dass Pfarrpersonen ihnen die entsprechenden Zahlen zur Verfügung stellen.
Ansprechpersonen
Arbeitsstelle für Umweltfragen und Klimaschutz
- Gottorpstraße 14
26121 Oldenburg